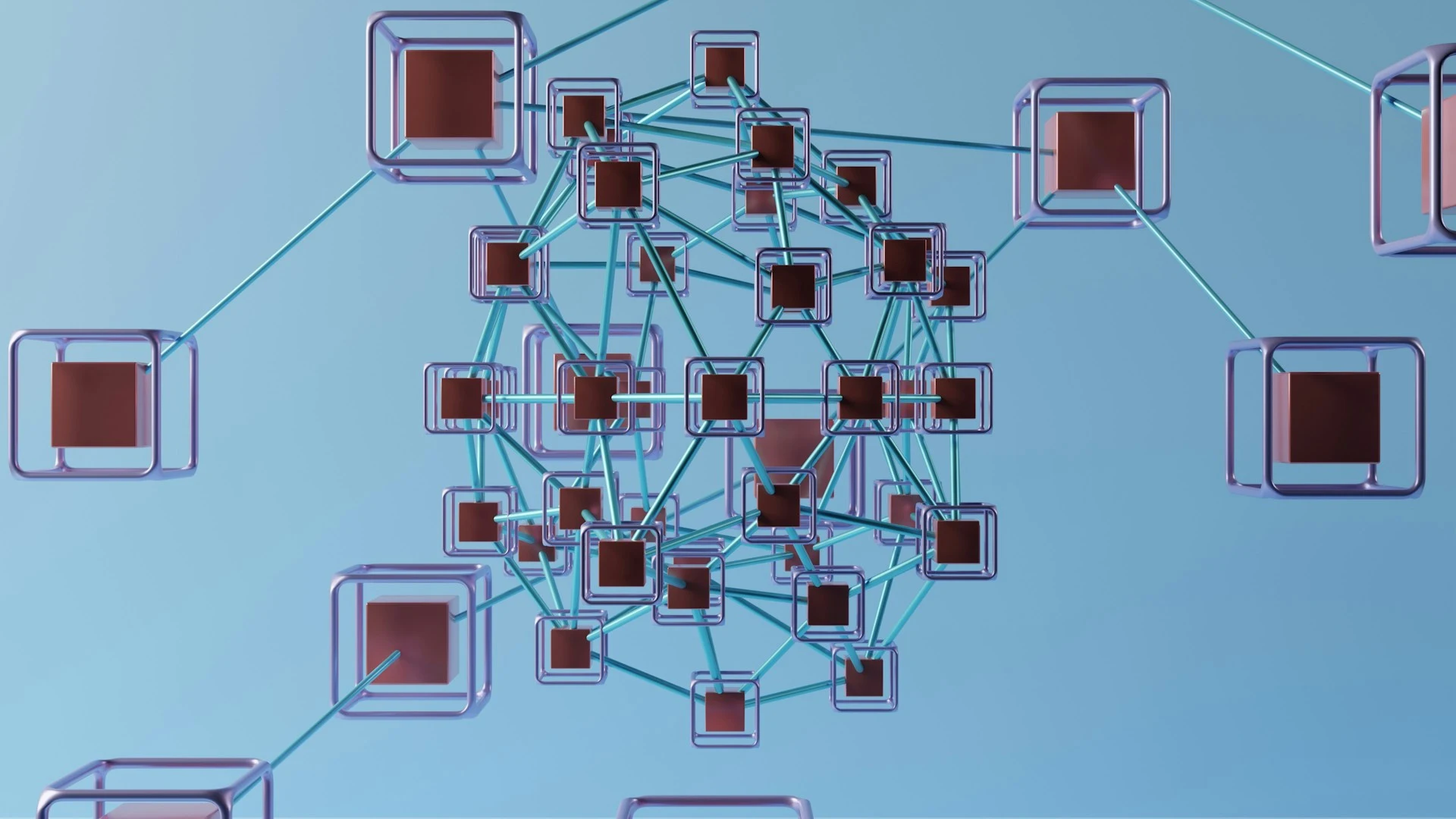Daten sammeln, strukturieren, nutzen: Der Praxisleitfaden für die Digitalisierung im Mittelstand

Daten sind Deutschlands unterschätzter Wettbewerbsvorteil. Während internationale Tech-Konzerne auf Infrastruktur und Modelle setzen, liegt die eigentliche Stärke Deutschlands in den hochwertigen, spezialisierten Daten des Mittelstands. Sie entstehen dort, wo Maschinen, Prozesse und Produkte täglich Wissen generieren – in der Produktion, der Logistik, im Handel.
Wenn diese Daten systematisch genutzt und verbunden werden, entsteht ein einzigartiges Potenzial: praxisnahe, branchenspezifische KI-Anwendungen, die den Unterschied im globalen Wettbewerb ausmachen können. Data Readiness wird damit zum Fundament der digitalen Wettbewerbsfähigkeit des Mittelstands.
Unser Leitfaden zeigt dir, wie du dieses Potenzial hebst: Wie du eine tragfähige Datenbasis aufbaust, Daten strukturierst und nutzbar machst – Schritt für Schritt zum Wettbewerbsvorteil.
Warum Data Readiness die Digitalisierung im Mittelstand antreibt
Technologien sind selten das eigentliche Hindernis bei der Digitalisierung im Mittelstand. Die meisten Tools, Plattformen und Systeme existieren bereits und sind auch für mittelständische Unternehmen erschwinglich. Der entscheidende Unterschied liegt in der Qualität und Verfügbarkeit deiner Daten. Die Herausforderung ist real: Während 82 Prozent der KMU Datenanalyse als strategisch wichtig ansehen, haben 75 Prozent keine systematische Datenstrategie.
Was gute Daten ermöglichen
Mit sauberen, strukturierten und zugänglichen Daten öffnen sich neue Möglichkeiten für dein Unternehmen.
Neue Systeme arbeiten mit vollständigen und präzisen Informationen. Automatisierungen liefern verlässliche Ergebnisse. Auswertungen führen zu fundierten Entscheidungen. KI-Tools können ihr volles Potenzial entfalten, weil sie auf einer soliden Grundlage lernen.
Die Investition in gute Datenqualität zahlt sich mehrfach aus: in schnellerer Umsetzung, besseren Ergebnissen und nachhaltigem Erfolg. Aus unserer Erfahrung im Austausch mit Entscheider:innen wissen wir: Data Readiness ist der Hebel, der digitale Initiativen vom Nice-to-have zum echten Wettbewerbsvorteil macht. Auch das Bundeswirtschaftsministerium setzt hier an und richtet sein Netzwerk der Mittelstand-Digital Zentren seit 2024 gezielt auf die Verfügbarkeit und Aufbereitung hochwertiger Daten aus.
Wer hier von Anfang an richtig investiert, profitiert langfristig: Die Implementierung läuft reibungsloser, Systeme arbeiten effizienter, und die Basis trägt alle zukünftigen Initiativen. Die gute Nachricht: Data Readiness ist strukturierte Arbeit, die systematisch angegangen werden kann.
Von der Bestandsaufnahme zur Strategie: Die fünf Schritte zur Datenreife
Um eine solide Datenbasis zu schaffen, brauchst du einen strukturierten Ansatz. Die folgenden fünf Schritte bilden die Grundlage für erfolgreiche digitale Transformation und zeigen, wie du deine Datenreife systematisch aufbauen kannst.
Schritt 1: Datenquellen identifizieren und bewerten
Bevor Daten strukturiert oder genutzt werden können, muss klar sein: Welche Daten sind überhaupt vorhanden? Wo liegen sie? Und wie relevant sind sie für deine Geschäftsziele?
Das Datenpotenzial entdecken
Die meisten Unternehmen haben deutlich mehr wertvolle Datenquellen, als ihnen bewusst ist. ERP-Systeme, CRM-Software, Excel-Tabellen, E-Mail-Postfächer, Produktionssysteme, Warenwirtschaft, Zeiterfassung, Website-Analytics, Social-Media-Accounts – die Liste ist lang und das Potenzial enorm.
Eine systematische Bestandsaufnahme bildet den Start. Eine Liste aller Systeme und Tools, in denen Daten entstehen, gespeichert oder verarbeitet werden, schafft Überblick. Wichtig dabei: Teams aus den Fachabteilungen einbeziehen. Oft wissen Mitarbeitende von Datenquellen, die der IT-Abteilung gar nicht bekannt sind.
Entscheidende Fragen dabei:
- Wo entstehen Transaktionsdaten?
- Wo liegen Kundendaten?
- Wo werden Prozessdaten erfasst?
- Wo stecken Produktdaten?
- Wo finden sich Finanzdaten?
- Wo sammeln sich Informationen aus der Kommunikation?
Relevanz systematisch einschätzen
Nicht alle Daten sind gleich wichtig für deine Digitalisierung. Manche sind geschäftskritisch, andere nice-to-have, wieder andere komplett irrelevant für strategische Ziele.
Eine Bewertung jeder identifizierten Datenquelle nach drei Kriterien schafft Klarheit:
Geschäftliche Relevanz: Wie wichtig sind diese Daten für Kernprozesse, Entscheidungen und Kundenbeziehungen? Daten mit direktem Zusammenhang zu Umsatz, Kundenzufriedenheit oder operativer Effizienz haben höchste Priorität.
Aktualität und Vollständigkeit: Werden die Daten regelmäßig gepflegt? Sind sie vollständig? Datenquellen mit sporadischer Pflege oder großen Lücken brauchen grundlegende Verbesserungen.
Zugänglichkeit: Wie hoch ist der Aufwand für Integration und Nutzung? Liegen Daten in modernen Systemen mit Schnittstellen oder in veralteten Legacy-Systemen? Sind sie digital oder teilweise noch auf Papier?
Diese Bewertung gibt dir einen ersten Überblick: Wo liegen deine wertvollsten Datenbestände? Wo ist der größte Nachholbedarf? Wo solltest du zuerst ansetzen? Durch den Austausch mit Unternehmen findest du wertvolle Antworten auf diese Fragen.
Datenarchitektur wird zur zentralen Führungsaufgabe. Auf dem data:unplugged Festival findest du genau diesen Kreis an Verantwortlichen – Entscheider:innen aus anderen mittelständischen Unternehmen, sowie Tech- und Rechtsexpert:innen, die offen darüber sprechen, wie sie Datenhoheit, Cloud-Souveränität und KI-Governance in ihren Unternehmen umsetzen, absichern und skalieren.
Schritt 2: Datenqualität bewerten und verbessern
Die Qualität deiner Daten entscheidet darüber, wie erfolgreich darauf aufbauende Prozesse funktionieren. Hohe Datenqualität ist der Schlüssel, damit Digitalisierungsprojekte ihr volles Potenzial entfalten können.
Die Ausgangslage ist dabei durchaus positiv: 62 Prozent der deutschen KMU weisen laut Bundesnetzagentur mindestens eine grundlegende digitale Intensität auf. Jetzt geht es darum, diese Basis durch hohe Datenqualität weiter auszubauen.
Die sechs Dimensionen der Datenqualität
Vollständigkeit: Sind alle notwendigen Felder ausgefüllt? Sind wichtige Informationen vorhanden? Ein vollständiger Kundendatensatz mit E-Mail-Adresse und Telefonnummer ermöglicht effektive Kommunikation in Marketing und Vertrieb.
Richtigkeit: Stimmen Adressen, Namen, Zahlen?
Konsistenz: Sind die gleichen Informationen in verschiedenen Systemen identisch? Wenn dein CRM und ERP die gleiche Kundenadresse führen, laufen Prozesse reibungslos und effizient.
Aktualität: Bei einigen Daten (wie Lagerbeständen) ist Echtzeit nötig, bei anderen reichen tägliche Updates. Aktuelle Daten ermöglichen fundierte Entscheidungen im richtigen Moment.
Eindeutigkeit: Jeder Kunde einmal im System mit korrektem Namen – so werden Daten zum verlässlichen Fundament für die Digitalisierung im Mittelstand.
Format: Strukturierte Datenfelder in standardisierten, maschinenlesbaren Formaten ermöglichen effektive Nutzung für KI-Anwendungen und Automatisierung.
Konkrete Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung
Für jede wichtige Datenart solltest du festlegen: Welche Felder sind Pflicht? Welche Formate sind erlaubt? Welche Regeln gelten für Eingaben?
Validierung bei der Erfassung sorgt für Qualität von Anfang an. Qualitätssicherung direkt bei der Eingabe spart später Zeit und Aufwand. Pflichtfelder, Format-Prüfungen, Dropdown-Menüs statt Freitextfelder – all das schafft von Beginn an saubere Daten.
Regelmäßige Datenaudits zeigen Optimierungspotenziale auf. Mindestens quartalsweise solltest du stichprobenartig prüfen: Wie steht es um die Datenqualität? Wo gibt es Verbesserungsmöglichkeiten? Welche Systeme oder Prozesse laufen besonders gut?
Automatisierte Bereinigung unterstützt bei großen Datenbeständen. Tools können Duplikate erkennen, Formatierungen vereinheitlichen oder Inkonsistenzen korrigieren. Wichtig: Automatisierung ergänzt die Arbeit an der Ursache und macht Prozesse effizienter.
Genau das hören wir immer wieder von den Expert:innen und Entscheider:innen mittelständischer Unternehmen, die in unserem data:unplugged Podcast ihre Erfahrungen teilen.
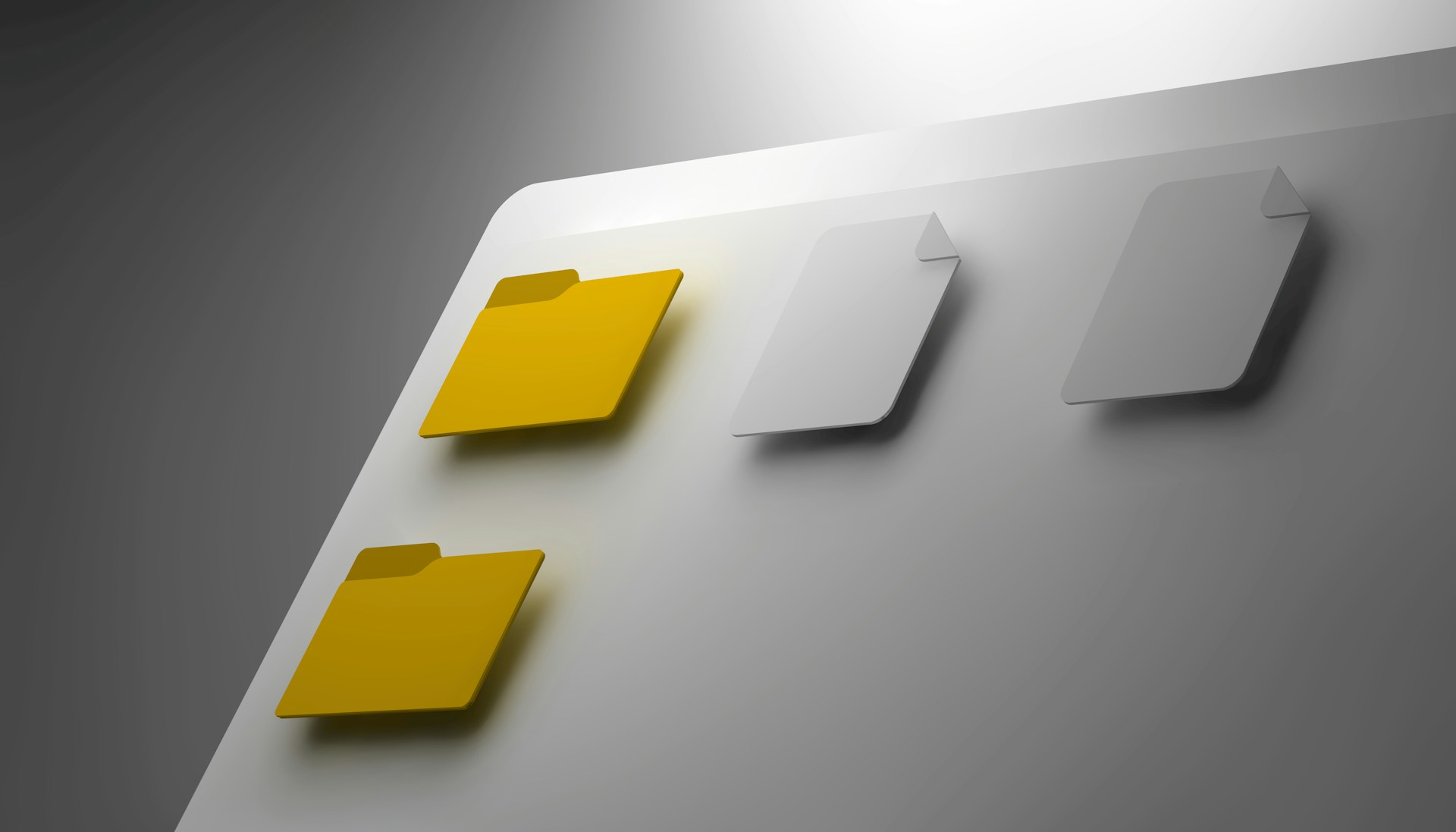
Schritt 3: Daten strukturieren und integrieren
Wenn du alle Datenquellen identifiziert und die Qualität verbessert hast, kommt der nächste wichtige Schritt: Wie bringst du verschiedene Datenquellen zusammen? Wie machst du sie vergleichbar und maximal nutzbar?
Master Data Management als Fundament
Master Data Management bedeutet: Es gibt eine zentrale, verlässliche Quelle für die wichtigsten Stammdaten in deinem Unternehmen. Einen Kunden, ein Produkt, einen Lieferanten – jeweils mit einer eindeutigen ID, die in allen Systemen gleich ist.
In der Praxis öffnet das neue Möglichkeiten: Klare Zuordnungen, eindeutige Referenzen und übergreifende Auswertungen werden möglich. Master Data Management schafft eine Single Source of Truth. Alle Systeme greifen auf die gleichen Stammdaten zu oder synchronisieren sich mit der zentralen Quelle.
Standardisierte Datenformate definieren
Für jede Datenart solltest du Standards definieren: Wie werden Datumsangaben formatiert? In welcher Einheit werden Mengen erfasst? Welche Kategorien gibt es für Produktgruppen? Wie werden Kund:innen-Stati dokumentiert?
Diese Standards schaffen Klarheit und ermöglichen reibungslose Zusammenarbeit zwischen Systemen. Wenn alle Systeme die gleiche Formatierung nutzen, wird die Zusammenführung zum Kinderspiel. Setze die Standards konsequent um: in neuen Systemen von Anfang an, in bestehenden Systemen durch Migration oder Mapping.
Schnittstellen für Integration schaffen
Die meisten Systeme müssen nicht alle Daten selbst vorhalten, aber sie müssen bei Bedarf darauf zugreifen können. Das funktioniert über Schnittstellen – APIs, Datenexporte, Synchronisationsmechanismen.
Moderne Systeme bringen meist APIs mit. Bei älteren Systemen kannst du auf Dateiexporte setzen. Wichtig ist: Automatisierung ermöglicht skalierbare, effiziente Prozesse.
Eine zentrale Data Warehouse oder Data Lake kann dabei helfen, verschiedene Datenquellen zusammenzuführen und für Auswertungen oder KI-Anwendungen bereitzustellen.
Schritt 4: Zugriff regeln und Sicherheit gewährleisten
Daten nutzbar zu machen bedeutet auch: den richtigen Personen den richtigen Zugriff zu geben. Data Governance schafft notwendige Struktur und Sicherheit für dein Unternehmen.
Rollenbasierte Zugriffsrechte implementieren
Jeder bekommt genau die Daten, die er für seine Arbeit braucht. Das gilt aus Datenschutzgründen, aber auch aus praktischen Erwägungen: Fokussierte Zugriffsrechte ermöglichen effizientes Arbeiten und erhöhen die Sicherheit. Rollenbasierte Zugriffsrechte bedeuten: Du definierst Rollen (z.B. Vertriebsmitarbeiter:in, Einkäufer:in, Controller:in) und vergibst jeder Rolle bestimmte Rechte. Neue Mitarbeitende bekommen dann die passenden Berechtigungen ihrer Rolle.
Das macht die Verwaltung einfacher, transparenter und sicherer. Und es erleichtert Audits: Du kannst jederzeit nachvollziehen, wer welche Rechte hat und warum.
Datenschutz und Compliance
Die DSGVO gibt einen sinnvollen Rahmen für den Umgang mit personenbezogenen Daten. Für die Digitalisierung im Mittelstand bedeutet das konkret:
Datenminimierung als Prinzip: Nur die Daten sammeln, die wirklich gebraucht werden. Mehr Daten bedeuten mehr Verantwortung, mehr Speicherkosten und höhere Risiken.
Zweckbindung beachten: Daten nur für die Zwecke nutzen, für die sie erhoben wurden. Kundendaten aus dem Vertrieb dürfen nicht einfach für Marketingaktionen genutzt werden, wenn der Kunde dem nicht zugestimmt hat.
Löschkonzepte definieren: Festlegen, wie lange welche Daten gespeichert werden müssen und wann sie gelöscht werden. Schlanke Datenbestände sind effizienter und sicherer.
Technische und organisatorische Maßnahmen umsetzen: Verschlüsselung, Backups, Zugriffsprotokolle, Sicherheitsschulungen – das Basispaket an Sicherheitsmaßnahmen muss vorhanden sein.
Governance etablieren
Klare Strukturen sorgen für Verlässlichkeit:
- Verantwortlichkeiten benennen: Wer ist für welche Daten verantwortlich? Wer darf neue Zugriffsrechte vergeben? Wer überwacht die Einhaltung von Standards?
- Prozesse dokumentieren: Wie werden neue Mitarbeitende ins System aufgenommen? Wie werden Zugriffsrechte bei Rollenwechsel angepasst? Wie läuft das Offboarding?
- Regelmäßige Reviews durchführen: Mindestens jährlich prüfen: Haben alle nur die Rechte, die sie brauchen? Gibt es verwaiste Accounts? Werden Sicherheitsstandards eingehalten?

Schritt 5: Datenkultur aufbauen und etablieren
Die beste Dateninfrastruktur nutzt nichts, wenn die Menschen in deinem Unternehmen nicht verstehen, warum Datenqualität wichtig ist, wie sie damit umgehen sollen und welchen Wert gute Daten haben. Eine Datenkultur zu etablieren ist der letzte – und oft unterschätzte – Schritt zur erfolgreichen Digitalisierung im Mittelstand.
Was ist Datenkultur?
Datenkultur bedeutet, dass datenbasierte Entscheidungen zur Norm werden. Dass Mitarbeitende Datenqualität als ihre Verantwortung verstehen. Dass Fragen gestellt werden: Auf welcher Grundlage wird das entschieden? Welche Daten liegen dazu vor? Wie valide sind diese Informationen?
Es bedeutet auch: Offenheit für das, was Daten zeigen – auch wenn es der eigenen Intuition widerspricht. Bereitschaft, aus Daten zu lernen statt sie zu ignorieren. Verständnis dafür, dass gute Daten Zeit und Pflege brauchen.
Wie lässt sich eine Datenkultur aufbauen?
Führung mit gutem Beispiel: Wenn Entscheider:innen Bauchentscheidungen treffen statt datenbasiert zu arbeiten, wird das Team das auch tun. Wenn nach Zahlen gefragt wird, Datenqualität eingemahnt und auf Basis von Fakten entschieden wird, sendet das ein klares Signal.
Wert von Daten sichtbar machen: Konkrete Beispiele zeigen, wo bessere Daten zu besseren Ergebnissen geführt haben. Wo eine Entscheidung auf Basis von Daten erfolgreicher war als eine auf Bauchgefühl. Diese Erfolgsgeschichten motivieren.
Team schulen: Nicht nur im technischen Umgang mit Systemen, sondern auch im Verständnis dafür, warum Datenqualität wichtig ist, wie Daten richtig interpretiert werden und welche Fehler zu vermeiden sind. Auf dem data:unplugged wird diese Wissensvermittlung gezielt gefördert - im Austausch mit anderen Entscheider:innen aus dem Mittelstand und für das gesamte Business-Team.
Transparenz schaffen: Daten zugänglich machen – im Rahmen der definierten Zugriffsrechte. Wer sieht, wie die eigene Arbeit sich in Zahlen niederschlägt, entwickelt oft mehr Verständnis für Zusammenhänge.
Feedback-Schleifen etablieren: Wenn Daten genutzt werden, um Prozesse zu verbessern oder Entscheidungen zu treffen, sollten die Ergebnisse zurück an die Teams kommuniziert werden, die diese Daten erfassen. So sehen sie, dass ihre Arbeit einen Unterschied macht.
Gute Datenpflege wertschätzen: Nicht finanziell, aber durch Anerkennung. Teams oder Mitarbeitende, die besonders auf Datenqualität achten, sollten sichtbar wertgeschätzt werden.
Typische Herausforderungen meistern
Gewohnheiten ändern: Neue Prozesse zur Datenerfassung oder -pflege fühlen sich zunächst ungewohnt an. Hier helfen Geduld, klare Erklärungen und das Aufzeigen konkreter Vorteile. Wenn Teams verstehen, wie sie von besseren Daten profitieren, steigt die Akzeptanz.
Vertrauen durch Transparenz: Manche sind zunächst unsicher, wie mehr Daten genutzt werden. Wichtig ist, zu kommunizieren: Es geht um bessere Entscheidungsgrundlagen und Prozessoptimierung. Transparenz schafft Vertrauen und zeigt den Mehrwert für alle.
Verständlich kommunizieren: Wenn Datenthemen zu technisch diskutiert werden, verlieren manche den Anschluss. Die Kommunikation sollte praxisnah und verständlich bleiben. Konkrete Use Cases und greifbare Beispiele machen Zusammenhänge deutlich.
Effizienz durch gute Systeme: In intensiven Phasen muss jeder Handgriff sitzen. Deshalb ist es wichtig, dass Datenpflege einfach und intuitiv ist – durch benutzerfreundliche Systeme, smarte Automatisierung und klare Prozesse. Gut designte Systeme sparen Zeit, statt sie zu kosten.
Selbsteinschätzung: Wo stehst du bei der Data Readiness?
Eine ehrliche Bewertung hilft, deinen aktuellen Stand der Datenreife einzuschätzen. Zentrale Fragen zu fünf Bereichen geben Orientierung:
- Bei Datenquellen: Vollständige Listen aller Systeme, Wissen um geschäftskritische Quellen und dokumentierte Verantwortlichkeiten
- Datenqualität: Definierte Standards, Validierungen bei der Eingabe, regelmäßige Audits und Kenntnis über Fehlerquoten
- Struktur und Integration: Master Data Management, Möglichkeit zur Zusammenführung verschiedener Datenquellen, dokumentierte Standards und implementierte Schnittstellen
- Zugriff und Sicherheit: Rollenbasierte Rechte, Konzepte für sensible Daten, DSGVO-Einhaltung und Prozesse für On- und Offboarding
- Datenkultur: Entscheidungen auf Datenbasis, Mitarbeitende verstehen den Wert guter Datenqualität, Schulungen finden statt, gute Datenpflege wird wertgeschätzt
Je mehr dieser Punkte du positiv beantworten kannst, desto besser steht es um deine Data Readiness.
Fazit: Das Fundament für erfolgreiche digitale Transformation
Daten sammeln, strukturieren und nutzen ist kein einmaliges Projekt, sondern ein kontinuierlicher Prozess und zentrale Führungsaufgabe. Deine Digitalisierung baut auf diesem Fundament auf – und je stabiler es ist, desto erfolgreicher werden alle darauf aufbauenden Initiativen sein. Ein systematisches Vorgehen in fünf Schritten schafft eine tragfähige Datenbasis. Datenqualität ist wichtiger als Datenmenge. Technologie ist nur die halbe Miete – eine Datenkultur zu etablieren ist mindestens genauso wichtig für deinen Erfolg.
Die Arbeit an der Datenbasis ist eine Investition, die sich mehrfach auszahlt: in besseren Entscheidungen, effizienteren Prozessen, zufriedeneren Kunden und letztlich in mehr Wettbewerbsfähigkeit. Aus unserer Erfahrung im Austausch mit Entscheider:innen wissen wir: Der Wandel hin zu datenbasierten Entscheidungen ist zentral für die Zukunft des Mittelstands und die erfolgreiche Anwendung neuer Technologien wie Künstliche Intelligenz.
Wie andere Mittelständler:innen diesen Weg konkret gegangen sind, erfährst du auf dem data:unplugged Festival 2026 am 26. & 27. März in Münster. Hier teilen Unternehmen aus den Bereichen E-Commerce, Industrie, Handel, Produktion und Logistik ihre selbst umgesetzten Use Cases zu Data Readiness, Datenkultur und Daten Souveränität: von Finance über Marketing, von IT bis Legal. Auf der Mittelstandsstage und weiteren vier Bühnen schaffen wir Raum für Austausch über fundierte Praxisbeispiele zu Daten und KI, um die Vorteile der KI-Technologie nicht nur zu verstehen, sondern aktiv zu gestalten.
Data Readiness betrifft alle Unternehmensbereiche: Für eine effektive Umsetzung ist es entscheidend, Key-Personen deines Unternehmens mitzunehmen, fortzubilden und positiv auf den Einsatz vorzubereiten. data:unplugged steht für eine breite und fundierte Wissensvermittlung - von der das gesamte Business-Team profitiert. Sicher dir jetzt ein Ticket für dich ein dein Kernteam!
Weitere Blogs
MCC Halle Münsterland